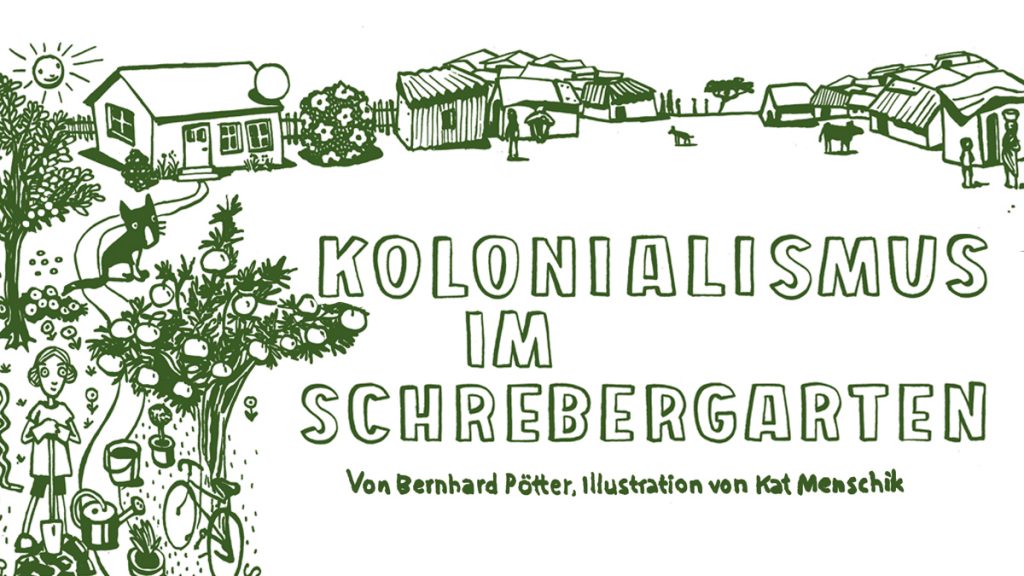Wir haben jetzt auch einen Schrebergarten. Mit Freunden teilen wir uns 250 grüne Quadratmeter in der Kolonie Sonnenbad: Vorn Rasen, zwei Apfelbäume, ein Birnbaum, irgendwo pflanzen wir Erdbeeren und Zucchini. Die kleine Hütte hat nur eine schmale Kochzeile, zwei Steckdosen, einen Mini-Kühlschrank, eine enge Toilette und eine Dusche.
Unsere Laube ist also ganz spartanisch. Und etwas, wovon eine Milliarde Menschen auf dieser Welt nur träumen können.
Jeder achte Mensch auf dieser Welt lebt in Slums, sagt die UNO. Sie gibt sogar einen zweijährlichen „Slum-Almanach“ heraus. Im aktuellen ist von einem großen Erfolg die Rede: Nicht mehr 39 Prozent aller Stadtbewohner weltweit leben in Slums, sondern „nur“ noch 30 Prozent. Aber die absolute Zahl steigt weiter. Ihre Wohnorte heißen je nach Region Favelas, Bidonvilles, Armen-Gegenden, „informelle Siedlungen“. Und auch die Zustände sind völlig unterschiedlich: Mal gibt es nur ein paar Baracken auf schlammigem Boden, mal feste Häuser und klare Sozialstrukturen. Es gibt sogar eine eigene Lobbygruppe: „Slum Dwellers International“, deren Vertreter auf Konferenzen für ihre Rechte kämpfen. Oft aber fehlt das Nötigste zu einem guten Leben: frisches Wasser, Toiletten, gesunde Lebensmittel, Jobs, Schulen, Sicherheit.
Für einen ordnungsgewohnten Europäer sind diese Wohngegenden ein Schlag in den Magen. Ich erinnere mich an das aggressive Menschengedränge in Dhaka, an den Staub in den hügeligen Vororten von Lima, wo ein klappriger Tankwagen den Menschen teures Trinkwasser verkaufte. Es sind nicht immer nur „Elendsquartiere“, sondern brodelnde Gegenden voller Leben, voller Kampf, aber auch manchmal voller Ideen und Zusammenhalt. Also so ziemlich das Gegenteil von unserer Kolonie Sonnenbad.
Vielleicht ist es kein Zufall, dass wir hier von „Kolonialismus“ reden. Denn eigentlich sollte damit Schluss sein: Vor zwei Jahren haben alle UN-Staaten die „nachhaltigen Entwicklungsziele“ (SDG) beschlossen – ein Katalog von 17 Zielen wie Armutsbekämpfung, Bildung und Umweltschutz. Das ist nicht mehr nur die klassische „Entwicklungshilfe“, die von den Reichen ein paar Almosen an die Armen gibt. Nein, die SDG machen es andersherum: Sie definieren auch die Industriestaaten als Entwicklungsländer. Denn unser Verbrauch von Öl und Gas, von Lebensmitteln, Fleisch und Wasser, unser Elektroschrott, unsere Chemieabfälle und unfairen Handelsverträge mit den Armen belasten das Leben deutlich mehr als jede Art von „Überbevölkerung“, die wir gern im globalen Süden anprangern.
Es ist andersherum: Wenn die Bewohner der Slums von Kalkutta und Rio genauso viel Kohle und Wasser verbrauchten wie wir in unserem Garten, wäre das Klima schon lange im Eimer. Wenn sie so viele Autos hätten wie wir, wäre bald alles verbrannt. Global gesehen müssen wir uns bei den Einwohnerndieser Viertel bedanken, dass sie bisher einen großen Teil des Kuchens uns überlassen, wenn wir samstagabends in unserer Laube den Grill anwerfen und ein Feierabend-Bier trinken. Diese Ungerechtigkeit schreit nicht nur zum Himmel. Sie wurde durch die „nachhaltigen Entwicklungsziele“ nun auch weltweit offiziell anerkannt. Stück für Stück müssen wir sie abbauen: Weniger billiges Fleisch auf unserem Grill, keine Holzkohle aus dem Regenwald. Nur noch fair gewebte T-Shirts für die Gartenarbeit, den Weg zur Laube mit dem Rad fahren. Dafür braucht es neue Verträge, mutige Politikerinnen und Unternehmer, die das durchsetzen.
Es ist schwer, seine Gewohnheiten aufzugeben. Aber wer sich in die Thematik einfühlen will, könnte mit seiner Familie einfach mal für ein halbes Jahr in einen Schrebergarten ziehen. Wenn alle in einem Raum schlafen, kaum Platz für ein Privatleben bleibt, die Kinder weite Wege zur Schule haben und es immer nur das einfachste Essen gibt, dann ist das hart – aber immer noch die Luxusvariante, weil irgendwo der Job und das Krankenhaus garantiert sind. So könnte vielleicht diese neue Form des Kolonialismus bei uns im Schrebergarten helfen, die Folgen des jahrhundertealten Kolonialismus ein bisschen besser zu verstehen. Und zu überwinden.
Über den Autor: Bernhard Pötter arbeitet als Redakteur für Wirtschaft und Umwelt bei der Tageszeitung taz in Berlin. Seine Themen sind vor allem Klima, Energie und Entwicklung im weltweiten und nationalen Maßstab – und die Querverbindungen dazwischen. Auf vielen Reisen hat er begriffen: Ohne Armutsbekämpfung und gutes Regieren gibt es keinen Umweltschutz und keinen Frieden.
 Dieser Artikel erschien zuerst im MISEREOR-Magazin „frings.“ Das ganze Magazin können Sie hier kostenfrei bestellen >
Dieser Artikel erschien zuerst im MISEREOR-Magazin „frings.“ Das ganze Magazin können Sie hier kostenfrei bestellen >